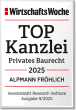Reform des EU-Designrechts: Mehr Schutz, mehr Wettbewerb, mehr Klarheit?
Die Europäische Union plant eine umfassende Reform des Designrechts. Ziel ist es, die bisherigen Regeln an die moderne Welt anzupassen – besonders im Hinblick auf die Digitalisierung und neue Technologien. Doch was bedeutet das konkret? Wir erklären die wichtigsten Punkte der Reform einfach und verständlich.
Warum wird das Designrecht überarbeitet?
Das bisherige EU-Designrecht stammt aus einer Zeit, in der es weder Smartphones noch digitale Designs gab. Heute entstehen viele Designs am Computer – etwa Benutzeroberflächen oder digitale Produkte, die man gar nicht anfassen kann. Die Reform soll solche Entwicklungen berücksichtigen und das Recht auf den neuesten Stand bringen.
Für wen ist das besonders relevant?
Die Reform wird insbesondere die Design-nahen Branchen interessieren wie Produktdesigner, die Mode-, Möbel- und Technologiebranche, die Automobil- und Ersatzteilbranche sowie Kreative und Künstler.
Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:
1. Harmonisierung und Modernisierung
Bislang gibt es auf nationaler Ebene (also z. B. in Deutschland, Frankreich etc.) und auf EU-Ebene teils unterschiedliche Regelungen. Diese sollen jetzt besser aufeinander abgestimmt und einfacher gemacht werden. Das soll Unternehmen den Schutz ihrer Designs erleichtern.
2. Erweiterter Schutz – auch für digitale Designs
In Zukunft sollen auch digitale Designs wie für Apps oder grafische Benutzeroberflächen (z. B. die Bedienoberfläche eines Navigationsgeräts) besser geschützt werden können. Dies betrifft allerdings nicht Computerprogramme selbst. 3D-Modelle oder Animationen konnten zwar vorher schon zur Eintragung gebracht werden – dies wird im Rahmen der Reform jedoch noch einmal klargestellt.
3. Reparaturklausel - Mehr Freiheit auf dem Ersatzteilmarkt
Ein besonders verbraucherfreundlicher Punkt: Künftig sollen Ersatzteile – etwa für Autos oder Haushaltsgeräte – auch ohne Zustimmung des Rechteinhabers von Drittherstellern angeboten werden dürfen, sofern sie ausschließlich zur Reparatur und Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds dienen.
Diese sogenannte „Reparaturklausel“ soll mehr Wettbewerb bringen – und das bedeutet für Verbraucher oft niedrigere Preise. Relevant wird dies wohl insbesondere für den Automobilsektor. Wie sich eine solche Klausel in der Praxis bewährt, und wie die Beschränkung auf den Reparaturbereich abgesichert werden kann, muss sich erst noch zeigen.
4. Design von Künstlicher Intelligenz – wer hat die Rechte?
Immer öfter entwerfen auch Computer und Künstliche Intelligenz (KI) neue Designs. Doch wem gehört so ein Design eigentlich – der KI, dem Programmierer oder dem Nutzer? Diese Frage bleibt in der Reform bisher unbeantwortet. Fachleute fordern hier schon lange klare Regeln.
Hinzu kommt ein weiteres Risiko beim Einsatz von KI: Die erzeugten Inhalte können Urheberrechte Dritter verletzen. Können die Quellen nicht überprüft und damit eventuell erforderliche Nutzungsrechte nicht eingeholt werden, kann man aufgrund des erheblichen Risikos von Urheberrechtsverletzungen nur von einer Benutzung abraten.
5. Einfachere Anmeldung und mehr Flexibilität
Wer ein Design schützen lassen will, soll dies künftig einfacher und flexibler tun können. Es wird auch möglich sein, die Veröffentlichung eines Designs aufzuschieben – zum Beispiel, wenn ein Produkt noch nicht auf dem Markt ist.
Fazit: Modern, digital und verbraucherfreundlich – auch, wenn einige Fragen offen bleiben
Die geplante Reform ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines modernen, digitalen Designrechts. Sie bringt Vorteile für Unternehmen, die leichter Schutz für ihre Ideen bekommen, und für Verbraucher, die mit günstigeren Ersatzteilen rechnen können.
Kritik gibt es allerdings auch: Vor allem beim Thema KI fehlt es noch an klaren Regeln – und das könnte in Zukunft für Unsicherheit sorgen.
Wenn die Reform wie geplant umgesetzt wird, könnte das europäische Designrecht zukunftssicher, gerechter und verbraucherfreundlicher werden – ein wichtiger Schritt für den digitalen Binnenmarkt der EU.
Autorin
- Dr. Marisa MichelsPartnerinFachanwältin:Gewerblicher RechtsschutzStandort:Münster / VerspoelTelefon:E-Mail:
Weitere Ansprechpartner
- Ilka Heß, LL.M.PartnerinFachanwältin:Gewerblicher RechtsschutzStandort:Münster / VerspoelTelefon:E-Mail: