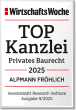Legal Due Diligence im Mittelstand – Taktgeber zum Erfolg des Unternehmenskaufs
Im Mittelstand ist die Due Diligence häufig der erste echte „Stresstest“ vor einem Unternehmenskauf. Besonders die Legal Due Diligence (LDD) gibt dabei den Takt vor: Sie identifiziert rechtliche Risiken, schafft Verhandlungsspielräume und sichert den Vollzug ab.
Während Konzerne hierfür zumeist standardisierte Abläufe etabliert haben, sind die Prozesse im Mittelstand meist weniger formalisiert. Eine gut strukturierte Due Diligence schafft hier Transparenz und macht aus verstreuten Informationen belastbare Entscheidungsgrundlagen für Bewertung, Kaufpreismechanik und Vertragsarchitektur.
Ziel und Bedeutung der Due Diligence
Due Diligence bedeutet wörtlich übersetzt „gebotene Sorgfalt“. In der Praxis beschreibt sie die strukturierte Analyse eines Unternehmens, um Chancen und Risiken zu erkennen und eine fundierte Vertragsentscheidung treffen zu können.
Für den Käufer ermöglicht die Prüfung eine realistische Bewertung des Unternehmens, die Einschätzung von Risiken sowie die Absicherung durch entsprechende Garantien und Freistellungen.
Für den Verkäufer kann eine gute Vorbereitung auf die Due Diligence entlastend wirken und spätere Haftungsrisiken reduzieren.
In der Regel werden mehrere Teilprüfungen durchgeführt, etwa:
- Legal Due Diligence (u.a. Gesellschaftsrecht, Verträge, Rechtsstreitigkeiten)
- Financial Due Diligence (u.a. Analyse der wirtschaftlichen Lage, Jahresabschlüsse, Liquidität),
- Tax Due Diligence (u.a. steuerliche Risiken, Betriebsprüfungen)
- Commercial Due Diligence (u.a. Markt- und Wettbewerbsanalyse)
- Real Estate / Environmental Due Diligence (u.a. Grundstücke, Altlasten, Umweltfragen)
Die Legal Due Diligence dient insbesondere der Früherkennung rechtlicher „Red Flags“ (z. B. fehlende Zustimmungen, lückenhafte IP-Rechteketten, kartell- oder arbeitsrechtliche Risiken).
Die identifizierten Befunde werden anschließend in konkrete Instrumente übersetzt: Garantien und Freistellungen, aufschiebende Bedingungen – etwa Freigaben in der Fusions- und Außenwirtschaftskontrolle –, Nebenabreden (Covenants) bis zum Closing sowie die passende Kaufpreismechanik (Locked-Box oder Closing-Accounts).
Ablauf der Due Diligence
In der Praxis erfolgt die Due Diligence in mehreren Phasen:
1. Vorbereitung
Bevor irgendein Dokument geteilt wird, steht regelmäßig zuerst eine Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement bzw. kurz: NDA). Dieses regelt Vertraulichkeit, zulässige Nutzung der Informationen sowie Rückgabe/Löschung und schafft damit die Grundlage für den weiteren Prozess.
Ausgangspunkt des weiteren Prüfungsprozesses ist sodann die Anforderungsliste bzw. Checkliste der Käufer, die die Prüfungsfelder strukturiert und den Dokumentenzugang steuert. Im Rahmen unserer Begleitung bereiten wir für Sie im Vorfeld eine strukturierte und auf die spezifische Unternehmenstransaktion zugeschnittene Übersicht der erforderlichen Unterlagen und Informationen auf.
Erst nach Abschluss des NDA wird der virtuelle Datenraum eingerichtet und stufenweise mit Unterlagen befüllt. Sensible Informationen werden – wo nötig – geschwärzt oder anonymisiert. Dabei ist auch darauf zu achten, dass DSGVO-Vorgaben eingehalten und insbesondere persönliche Daten über Mitarbeiter nicht ungefiltert weitergegeben werden.
Bei Wettbewerbsnähe kann ein Clean-Team-Ansatz sinnvoll sein, damit wettbewerbssensible Details nicht direkt ins operative Deal-Team fließen. Bestimmte sensible Daten werden dabei nur von einem kleinen, unabhängigen Team geprüft, um kartellrechtliche Vorgaben einzuhalten.
2. Prüfung
Im nächsten Schritt werden die bereitgestellten Dokumente durch die Käuferseite analysiert. Im Rahmen der Legal Due Diligence stehen insbesondere folgende Aspekte im Mittelpunkt:
- Gesellschaftsrechtliche Strukturen und Beteiligungsverhältnisse (insbesondere sog. „Chain of Title“)
- Wesentliche Vertragsverhältnisse (u.a. betreffend Kunden, Lieferanten, Händler, Finanzierung, IT/SaaS/Cloud)
- Compliance (etwa mit der DSGVO oder kartellrechtlichen Vorgaben)
- Arbeitsrechtliche Fragestellungen (Arbeitsverträge, Belegschaftsstruktur, Organbestellungen, Incentive-Programme, Mitbestimmung und – im Asset Deal – die Folgen des Betriebsübergangs (§ 613a BGB))
- IP (z.B. Marken-/Patent-/Designrechte, Urheberrechte, Lizenzketten)
- Anhängige Rechtsstreitigkeiten
- Behördliche Genehmigungen und Bescheide
- Immobilien- und umweltrechtliche Fragen
Offene Punkte klären wir über einen geregelten Q&A-Prozess, damit Nachfragen nicht per E-Mail verstreut werden und die DSGVO-Vorgaben eingehalten bleiben.
3. Auswertung und Bericht
Die Ergebnisse werden anschließend durch uns in einem Legal Due Diligence-Bericht zusammengeführt. Je nach Art und Umfang der Transaktion kann dieser wahlweise als kompaktes Red-Flag-Format (fokussiert auf wesentliche Risiken) oder umfassender Bericht ausgestaltet werden.
Der zum Stichtag dokumentierte Snapshot des Datenraums dient dabei als Referenz für die offengelegten Informationen im Vertrag und schafft Nachweisbarkeit für beide Seiten.
Fazit
Eine gut vorbereitete und strukturierte Legal Due Diligence ist der Taktgeber jeder Transaktion. Sie schafft Transparenz, erhöht die Vollzugssicherheit und reduziert Haftungsrisiken auf Käufer- wie Verkäuferseite.