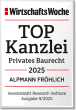Mindestlohnerhöhung 2026 und 2027: Was Unternehmen wissen müssen und wie sie sich vorbereiten können
Am 29. Oktober 2025 hat das Bundeskabinett die Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung verabschiedet. Diese Verordnung sorgt für eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Zum 1. Januar 2026 wird der Mindestlohn daher von aktuell 12,82 Euro auf 13,90 Euro pro Stunde steigen, und ab dem 1. Januar 2027 wird er auf 14,60 Euro pro Stunde angehoben. Damit ergibt sich eine Gesamtsteigerung von 13,88 % in nur zwei Jahren – eine der größten Anpassungen seit Einführung des Mindestlohns.
Für Unternehmen bedeutet diese Erhöhung nicht nur eine Anpassung der Löhne, sondern macht auch eine umfassende Überprüfung der Vergütungsmodelle und Personalstrukturen erforderlich. Besonders wichtig ist die mögliche Änderung der Minijob-Grenzen und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen. In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie sich als Unternehmen auf diese Änderungen vorbereiten können.
1. Die Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung 2026 und 2027
Die geplante Erhöhung des Mindestlohns wird weitreichende Folgen für Unternehmen und Arbeitnehmer haben. Die Erhöhung des Mindestlohns erfolgt in zwei Schritten:
- 1. Januar 2026: Der Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro pro Stunde (eine Erhöhung von 8,42 %).
- 1. Januar 2027: Der Mindestlohn wird auf 14,60 Euro pro Stunde angehoben (eine weitere Erhöhung von 5,04 %).
Insgesamt bedeutet dies eine Steigerung von 13,88 % innerhalb von zwei Jahren, was erhebliche Auswirkungen auf die Lohnstruktur vieler Unternehmen haben wird. Für viele Unternehmen, die bereits am Rand ihrer Margen arbeiten oder eine große Zahl von Minijobbern beschäftigen, kann dies zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen.
Warum die Erhöhung wichtig ist und welche Unternehmen sie besonders trifft
Die Erhöhung des Mindestlohns ist eine Antwort auf die steigenden Lebenshaltungskosten und das zunehmende Forderungen nach einer gerechteren Entlohnung. Für Unternehmen ist dies jedoch eine Herausforderung, besonders in Bereichen mit knappen Margen wie dem Gastronomiebereich oder Handwerksbetrieben, die viele Minijobber beschäftigen. Hier müssen Arbeitszeitmodelle und Lohnkosten genau überprüft werden, um negative Auswirkungen zu vermeiden.
2. Minijobber und die mögliche Anpassung der Verdienstgrenzen
Ein oft übersehener Punkt ist die Anpassung der Minijob-Grenzen. Aktuell können Minijobber bis zu 556 Euro monatlich verdienen, kurzfristig beschäftigte Minijobber haben keine Beiträge zu zahlen, die Personen, die mit Verdienstgrenze arbeiten und sich zur Beitragszahlung in die Rentenversicherung entschieden haben, zahlen 3,6 % Eigenanteil. Der Arbeitgeber führt ggf. pauschale Beiträge zur Sozialversicherung ab. Wird der Mindestlohn jedoch angehoben, könnten Minijobber durch die höhere Stundenvergütung diese Grenze überschreiten, auch wenn sie ihre Arbeitszeit nicht erhöhen.
Beispiel aus der Praxis:
Ein Gastronomiebetrieb mit vielen Minijobbern könnte durch die Mindestlohnerhöhung plötzlich in die Situation kommen, dass ein Teil der Minijobber die Grenze von 556 Euro überschreitet, selbst bei der gleichen Arbeitszeit. Beispielsweise könnte ein Minijobber mit einem aktuellen Stundenlohn von 12,82 Euro bei 40 Stunden im Monat auf 512,80 Euro kommen. Bei einem neuen Mindestlohn von 13,90 Euro überschreitet der Minijobber die Grenze bereits bei 36,9 Stunden. In diesem Fall wären plötzlich für alle Beteiligten Sozialversicherungsbeiträge fällig, was zusätzliche Kosten für den Betrieb verursachen würde.
Was könnte sich ändern?
Es gibt Überlegungen, die Minijob-Grenzen an den gestiegenen Mindestlohn anzupassen, doch eine gesetzliche Regelung hierzu steht noch aus. Unternehmen sollten daher proaktiv die Arbeitszeitmodelle ihrer Minijobber prüfen und sicherstellen, dass die Verdienstgrenze nicht überschritten wird, wenn der Mindestlohn steigt.
3. Was Unternehmen jetzt tun sollten: Frühzeitige Planung und Anpassung
Angesichts der bevorstehenden Mindestlohnerhöhung und der möglichen Anpassung der Minijob-Grenzen sollten Unternehmen bereits jetzt handeln, um sich optimal auf die kommenden Änderungen vorzubereiten. Eine rechtzeitige Planung und Anpassung sind entscheidend, um unerwartete Kosten und rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden.
a. Überprüfung der Personalstrukturen
Unternehmen sollten ihre Personal- und Vergütungsstrukturen auf den Prüfstand stellen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die Minijobber beschäftigen oder deren Mitarbeiter derzeit nur knapp über dem Mindestlohn verdienen. Falls die Stundenvergütung aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns die Grenze von 556 Euro überschreiten könnte, sollten Anpassungen in den Arbeitsverträgen und der Arbeitszeit vorgenommen werden.
b. Vorsorglich Kalkulation der Lohnkosten
Unternehmen sollten die Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf ihre Lohnkosten kalkulieren. Dies umfasst sowohl die direkten Lohnkosten als auch mögliche Zusatzkosten durch Sozialversicherungsbeiträge. Szenarien wie eine Überprüfung der Lohnstrukturen in Abhängigkeit vom Stundenlohn und den Arbeitszeiten der Mitarbeiter sind wichtig.
c. Anpassung der Minijob-Verträge
Prüfen Sie, ob durch die Erhöhung des Mindestlohns Ihre Minijobber plötzlich sozialversicherungspflichtig werden. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, Arbeitszeitmodelle anzupassen oder auf alternative Beschäftigungsmodelle umzusteigen, um höhere Kosten zu vermeiden.
Achtung: die Anpassungen müssen einvernehmlich erfolgen. Denn aus der Pflicht, in einem bestimmten Umfang zu arbeiten, folgt nämlich auch das Recht der Beschäftigten, in diesem Umfang tätig zu sein.
4. Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen
Neben den direkten Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf die Löhne und Minijob-Grenzen gibt es auch steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Implikationen, die von Unternehmen berücksichtigt werden sollten.
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge
Mit der Erhöhung des Mindestlohns werden viele Arbeitnehmer möglicherweise in eine höhere Steuerklasse rutschen, was die Lohnsteuer beeinflusst und zu einer höheren Steuerlast führen könnte. Auch die Beiträge zur Sozialversicherung können steigen, was für Unternehmen zusätzliche Kosten mit sich bringt.
Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass sie die Brutto- und Netto-Lohnkosten genau kalkulieren und gegebenenfalls neue Berechnungen für die Lohnabrechnung vornehmen.
5. Fazit: Vorbereitung ist der Schlüssel
Die Mindestlohnerhöhung 2026 und 2027 stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Eine vorausschauende Planung ist entscheidend, um unerwartete Kosten und rechtliche Risiken zu vermeiden. Unternehmen sollten ihre Personal- und Vergütungsstrukturen prüfen, die Minijob-Grenzen im Blick behalten und eine genaue Kalkulation der Lohnkosten vornehmen.
Indem Unternehmen rechtzeitig Anpassungen vornehmen und rechtliche Beratung einholen, können sie sicherstellen, dass sie ab 2026 rechts- und planungssicher aufgestellt sind.
Checkliste für Unternehmen
- Personal- und Vergütungsstrukturen prüfen
- Minijob-Grenzen im Blick behalten
- Lohnkosten kalkulieren und Szenarien durchspielen
- Steuerliche Auswirkungen berücksichtigen
- Frühzeitig informierte Entscheidungen über das weitere Vorgehen treffen
Die kommenden Änderungen im Mindestlohn 2026 und 2027 sind komplex und erfordern eine sorgfältige Vorbereitung.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Prüfung von Arbeitsverträgen, Vergütungsmodellen oder bei der Einordnung von Minijob-Beschäftigungen.